 © Gregor Aas
© Gregor AasZuordnung | Alternative Baumart Kategorie 1 |
Verbreitung | Nördlicher Mittelmeerraum |
Standort | Geringe Ansprüche |
Lichtanspruch | Hoch |
Verwendung | Innenausbau, Konstruktionsholz |
Standortansprüche und besondere Merkmale
Die Standortsansprüche der Schwarzkiefer sind generell gering, variieren aber zwischen den Unterarten. Sie ist in der Lage trockene Extremstandorte wie Kippen und flachgründige Böden zu besiedeln.
Lichtbaumart
erträgt nur sehr wenig Schatten
Boden muss gut durchlüftet sein
keine besonderen Ansprüche
keine Staunässe oder hochstehendes Grundwasser
keine Überflutungsbereiche
kommt bis an die Trockengrenze des Waldes vor
nährstoffarme bis nährstoffreiche Böden
für sandige und sehr steinige Böden geeignet
für dichte tonige Böden geeignet
submediterran
erträgt Trockenheit gut
erträgt Spätfrost gut
Klimaeignung für Bayern
Das gegenwärtige Klima ist für die Schwarzkiefer nur in Regionen mit höheren Temperaturen geeignet. Weite Bereiche Bayerns sind noch zu kühl für die Baumart. Bei einer Temperaturerhöhung wird sie dagegen in fast allen Bereichen Bayerns zum Anbau geeignet sein. Ausschlussflächen beschränken sich dann nur noch auf wenige zu kalte Hochlagen und Standorte mit deutlichem Wasserüberschuss.
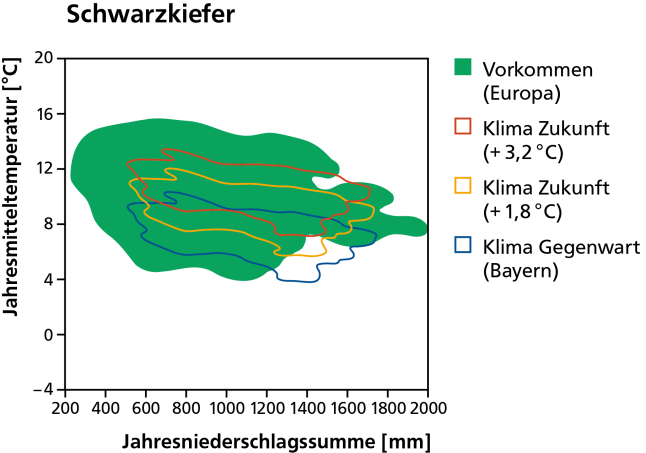 © StMELF
© StMELFDie Klimahüllen zeigen immer annähernd das maximale Verbreitungsgebiet der Baumarten, welches aus einem europäischen Datensatz berechnet wurde. An den Grenzen des Bereichs sind die Baumarten sehr anfällig, deshalb sollte vom Verbreitungsrand immer Abstand gehalten werden.
Erfahren Sie, welche Baumarten sich künftig für den Anbau in Ihrer Region eignen. Dazu haben wir heimische, seltene und alternative Baumarten hinsichtlich ihres Anbaurisikos im Klimawandel eingewertet. Die Ergebnisse wurden auf Basis regionaler Einheiten, den forstlichen Wuchsbezirken in Bayern, zusammengefasst.
Regionale Anbaueignung – WuchsbezirksauswahlWaldbauliche Behandlung
Die Schwarzkiefer ist eine sehr lichtbedürftige, aber robuste und anspruchslose Baumart. Sie sollte nur in gemischten Beständen aus mehreren Baumarten bewirtschaftet werden. Dazu werden in jedem Bestandsalter entsprechend der Mischungsziele 100 - 150 Einzelbäume (Kiefern oder Mischbaumarten) ausgesucht sowie anfangs moderat und später - etwa ab Alter 20 - deutlich beherzter von bedrängenden Nachbarbäumen befreit. So können sich die Kronen der Wunschbäume ungehindert zur Seite und nach oben hin entwickeln. Sobald sich der Kronenfreiraum wieder zu schließen beginnt und das Kronenwachstum behindert wird, steht die nächste Durchforstung zugunsten der 100 - 150 Wunschbäume an (Baumabstand etwa 8 - 10 Meter). Dies kann bereits nach 3 - 5 Jahren der Fall sein.
Die Schwarzkiefer gilt als Rohbodenkeimer. Auf dicken Humusdecken und im Grasfilz können ihre Sämlinge kaum gedeihen. Entfernt man auf Teilflächen die organische Auflage, bis der darunterliegende Mineralboden freiliegt, so kann sich von alleine Kiefernnachwuchs einstellen.
Mischung
Unter den lichten Kronen von Schwarzkiefern etablieren sich oft artenreiche Mischwälder mit Traubeneiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Elsbeere, Speierling oder Feldahorn.
Verwendungsmöglichkeiten
Verwendung findet das Holz der Schwarzkiefer im Innenausbau, für Bodenbeläge, im Schiffsbau, als Konstruktionsholz, als Sperrholz und in der Papier- und Zellstoffindustrie.
Waldschutz - Gefahren für die Schwarzkiefer
In Deutschland nimmt auf ungünstigen Standorten, nach Trockenheitsperioden und in Reinbeständen die Schadanfälligkeit der Schwarzkiefer deutlich zu. In den letzten Jahren breitet sich das Diplodia-Triebsterben (Erreger Sphaeropsis sapinea) stark aus. Der schon in Südtirol, Slowenien und im Elsass aufgetretene Kiefernprozessionsspinner mit seinen Gifthärchen hat hohes Schadpotenzial. Die Baumart ist anfällig für Schneebruch.
Artenvielfalt
Unter der Schwarzkiefer können sich Sträucher des wintergrünen Kiefernwaldes etablieren. Durch ihre lichte Krone ermöglicht sie das Entstehen eines artenreichen Mischwaldes. Verschiedene Vogelarten bedienen sich ihrer Samen als Nahrung.
Weitere Informationen

Fragen kostet nichts! Unsere Beratungsförsterinnen und -förster helfen bei Fragen zu Ihrem Wald gerne weiter. Mit unserem praktischen Försterfinder können Sie schnell Ihren zuständigen Förster oder Ihre Försterin finden.
Försterfinder
